Markieren und Scheinmarkieren – Kommunikation im Mehrkatzenhaushalt
Wenn Katzen beginnen, an Möbeln oder Wänden Urin zu versprühen, sorgt das bei vielen Haltern für Verunsicherung. Schnell entsteht die Annahme, es handle sich um Unsauberkeit oder gar um eine Art Protest. Tatsächlich aber gehört Markieren zu den zentralen Kommunikationsformen von Katzen. Auch das sogenannte Scheinmarkieren, bei dem die typischen Bewegungen des Sprühens ohne Urinabgabe gezeigt werden, ist Teil dieses stillen Dialogs. Gerade in Mehrkatzenhaushalten spielen beide Verhaltensweisen eine wichtige Rolle, weil hier soziale Beziehungen und Rangordnungen ständig neu ausgehandelt werden.
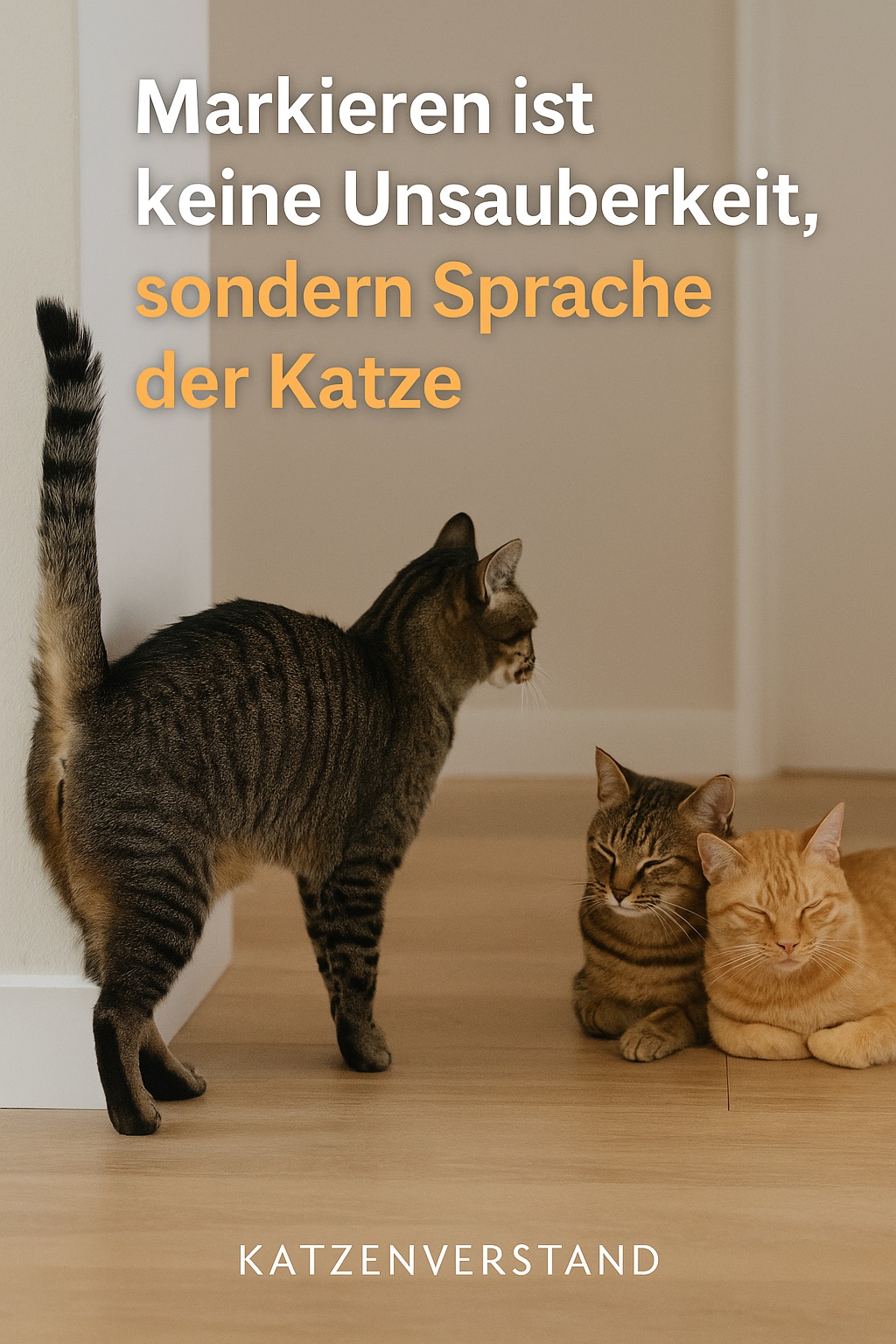
„Markieren ist keine Unsauberkeit, sondern Sprache der Katze.“ - Katzengesellschaft
Markieren als komplexes Kommunikationssystem
Markieren ist kein unerwünschter Zufall, sondern ein hochentwickeltes Kommunikationsmittel. Ethologisch betrachtet handelt es sich um eine Form der chemischen Sprache. Der Urin transportiert nicht nur Abbauprodukte, sondern auch eine Vielzahl von Pheromonen, die Informationen über Geschlecht, Fortpflanzungsstatus, Stresslevel und sogar über die individuelle Identität enthalten (Bradshaw & Cameron-Beaumont, 2000; Ramos et al., 2020).
Die Positionierung der Markierungen ist ebenfalls alles andere als zufällig. Katzen setzen ihre Duftspuren bevorzugt an neuralgischen Punkten wie Türen, Fensterrahmen oder Durchgängen. Dort, wo Begegnungen wahrscheinlich sind, entfalten die Signale ihre größte Wirkung. Auf diese Weise entstehen unsichtbare Duftlinien, die das Territorium strukturieren. Markieren dient damit nicht nur der Abgrenzung, sondern ist auch ein Instrument zur Konfliktvermeidung: Jede Katze erkennt, dass der Platz bereits beansprucht wurde, ohne dass es zu einer direkten Auseinandersetzung kommt.
Bemerkenswert ist zudem, dass dieses Verhalten nicht nur bei unkastrierten Katern vorkommt. Auch kastrierte Kater und weibliche Katzen nutzen Markieren, wenn es um soziale Abgrenzung, Sicherheit oder Stressbewältigung geht.
Scheinmarkieren – das stille Signal
Beim Scheinmarkieren wird die gleiche Körperhaltung wie beim Sprühen eingenommen: die Katze steht aufrecht, hebt die Hinterhand leicht an, der Schwanz zittert, doch Urin tritt keiner aus. Lange galt dieses Verhalten als „Fehlversuch“. Heute gilt es als eigene Form des Ausdrucks: ein Signal ohne Geruchsspur.
Dieses Verhalten erlaubt es einer Katze, ihre Anwesenheit und emotionale Lage anzudeuten, ohne eine dauerhafte Duftmarke zu hinterlassen. Besonders zurückhaltende Tiere nutzen es, um Präsenz zu zeigen, ohne dominante Artgenossen herauszufordern. Man könnte es als eine Art „leises Flüstern“ innerhalb der Katzengruppe verstehen, das den lauten „Ruf“ des echten Markierens ergänzt.
Beispiel aus dem Alltag – Mitreden ohne Lautstärke
Ein eindrucksvolles Beispiel zeigt sich in einem Mehrkatzenhaushalt mit drei Katern: Zwei genießen es, morgens gebürstet zu werden. Sie drängen sich von selbst an die Bürste, schnurren und reiben sich daran. Der dritte Kater beobachtet zunächst aus der Distanz. Schließlich nähert er sich, zeigt das typische Schwanzzittern des Markierens – doch es tritt kein Urin aus.
Verhaltensbiologisch betrachtet nutzt er das Scheinmarkieren als Möglichkeit, sich in die soziale Szene einzubringen, ohne einen offenen Anspruch zu erheben. Er signalisiert: „Ich bin auch da, das betrifft mich ebenfalls“, ohne mit den beiden anderen um die begehrte Ressource konkurrieren zu müssen. Dieses Verhalten spiegelt einen inneren Konflikt wider: den Wunsch nach Teilhabe einerseits, die Unsicherheit andererseits. Ethologen sprechen in solchen Fällen von Übergangsverhalten, das Spannungen abbaut, ohne in Aggression oder Rückzug zu münden. Für den Halter ist dieses subtile Verhalten ein Hinweis auf die feine Abstufung der sozialen Rollen innerhalb der Gruppe.
In Mehrkatzenhaushalten ist Markieren besonders häufig. Die Tiere nutzen es, um Territorien abzustecken, Rollen zu definieren und soziale Stabilität zu sichern. Während in harmonischen Gruppen andere Verhaltensweisen wie gegenseitiges Putzen, synchrones Ruhen oder das Teilen von Liegeplätzen dominieren, steigt die Häufigkeit von Markierungen bei Instabilität deutlich an.
Ellis et al. (2015) konnten zeigen, dass Faktoren wie eine unzureichende Zahl von Katzenklos, fehlende Rückzugsmöglichkeiten oder Konkurrenz um Futterstellen die Wahrscheinlichkeit für Markierverhalten erhöhen. Dabei zeigt sich oft ein Muster: Dominante Tiere setzen echte Urinmarken, während rangniedrigere Katzen eher auf das „flüsternde“ Scheinmarkieren zurückgreifen.
Markieren und Kastration – hilft es wirklich?
Lange galt Markieren als klassisches Verhalten unkastrierter Kater. Tatsächlich markieren intakte Tiere besonders häufig, da der Urin wichtige Informationen über Fortpflanzungsstatus und hormonelle Verfassung transportiert. Unkastrierte Katzen in Rolligkeit nutzen Markieren ebenfalls, um ihre Paarungsbereitschaft anzuzeigen.
Eine Kastration reduziert das Markierverhalten in vielen Fällen deutlich. Studien zeigen, dass 80–90 % der Kater nach einer Kastration weniger oder gar nicht mehr markieren (Hart & Barrett, 1973; Pryor et al., 2001). Auch die Intensität des Geruchs nimmt ab, da Sexualhormone wie Testosteron wegfallen.
Allerdings verschwindet das Verhalten nicht in jedem Fall. Etwa 10–20 % der kastrierten Katzen markieren weiterhin, insbesondere dann, wenn Stress, Unsicherheit oder Konkurrenz eine Rolle spielen. Die Motivation verschiebt sich: Während bei unkastrierten Tieren das Fortpflanzungssignal im Vordergrund steht, übernehmen bei kastrierten Katzen eher territoriale und emotionale Aspekte die Hauptrolle. Manche Katzen wechseln nach der Kastration vermehrt zum Scheinmarkieren, weil der hormonelle Antrieb geringer ist, die soziale Funktion jedoch bestehen bleibt.
Markieren als Stressanzeige
Neben territorialen und sozialen Aspekten ist Markieren auch ein zuverlässiger Indikator für Stress. Untersuchungen von Heidenberger (1997) belegen, dass die Häufigkeit von Markierungen in Wohnungen steigt, wenn Katzen vermehrt Stressoren ausgesetzt sind – etwa durch Veränderungen im Haushalt, Umzüge, neue Möbel oder den Einzug weiterer Tiere.
Physiologisch lässt sich dieser Zusammenhang erklären: Stresshormone wie Cortisol verändern die Zusammensetzung des Urins. Dadurch wird die Markierung für Artgenossen intensiver und transportiert zusätzliche Informationen: „Ich bin angespannt.“ Damit fungieren Markierungen gewissermaßen als Frühwarnsystem, das Haltern Hinweise auf das innere Befinden ihrer Tiere gibt.
Das Jacobson-Organ – wie Katzen Markierungen „lesen“
Damit Markierungen ihre Funktion erfüllen, braucht es die Fähigkeit, sie zu entschlüsseln. Katzen verfügen über ein zusätzliches Sinnesorgan, das Jacobson-Organ oder Vomeronasale Organ, das im Gaumen sitzt. Mit diesem Spezialorgan nehmen sie Pheromone auf und leiten sie direkt in das limbische System des Gehirns, wo Emotionen und soziale Bewertungen entstehen.
Wenn eine Katze an einer Markierung riecht und anschließend die Lippen leicht öffnet, ist dies das sogenannte Flehmen – ein typischer Hinweis darauf, dass sie die Duftstoffe über das Jacobson-Organ analysiert. Für uns riecht der Urin beißend, für die Katze enthält er jedoch eine Fülle an Informationen: Wer hat hier markiert, wann war das Tier da, in welchem hormonellen Zustand befindet es sich, und möglicherweise sogar, wie gestresst es war. Markieren ist also ein Informationsaustausch auf einer Ebene, die unserem Geruchssinn völlig verschlossen bleibt.
Individuelle Unterschiede – jede Katze ist anders
Nicht jede Katze markiert gleich viel, und nicht jede Katze reagiert gleich stark auf die Markierungen anderer. Persönlichkeitsforschung bei Katzen zeigt, dass es stabile Charakterunterschiede gibt, die ihr Verhalten prägen. Mutigere und selbstbewusstere Tiere setzen häufiger deutliche Markierungen, weil sie ihren Anspruch offensiv formulieren. Sensiblere oder ängstlichere Katzen hingegen neigen dazu, nur gelegentlich oder in abgeschwächter Form – etwa durch Scheinmarkieren – Signale zu setzen.
Auch frühere Erfahrungen spielen eine Rolle. Katzen, die in ihrer Jugend gelernt haben, mit anderen friedlich zu koexistieren, markieren oft weniger. Tiere, die in instabilen Gruppen oder unter starkem Stress aufwuchsen, neigen dagegen eher dazu, ihre Position ständig neu abzusichern. In Mehrkatzenhaushalten zeigt sich deshalb ein breites Spektrum – von Katzen, die fast nie markieren, bis hin zu jenen, die regelmäßig Duftspuren hinterlassen.
Wohnungskatzen und Freigänger
Bei Freigängern verlagert sich Markieren meist in den Außenbereich. Büsche, Gartenmöbel oder Mauern werden zu natürlichen Duftträgern, sodass die Halter das Verhalten kaum bemerken. Wohnungskatzen hingegen haben keine Möglichkeit, ihr Revier draußen zu kennzeichnen. Sie konzentrieren das Verhalten auf den Innenraum, was für den Menschen viel auffälliger ist. Der Unterschied liegt also weniger im Verhalten selbst als in der Sichtbarkeit.
Weitere wissenschaftliche Hintergründe
Hat eine Katze einmal eine bestimmte Stelle markiert, kann der verbliebene Geruch selbst zum Auslöser werden. Selbst wenn der ursprüngliche Auslöser verschwunden ist, verstärkt der Restgeruch das Verhalten über klassische Konditionierung. Deshalb ist gründliche enzymatische Reinigung so wichtig – sonst „zieht“ der Geruch die Katze immer wieder an denselben Ort zurück.
In Mehrkatzenhaushalten geht es beim Markieren nicht nur darum, das eigene Territorium zu kennzeichnen, sondern auch darum, die Spuren anderer zu überlagern. Katzen reagieren häufig auf die Markierung eines Rivalen mit einer eigenen, es entsteht ein „Duftdialog“ oder sogar ein Markierungswettlauf. Das kann in Situationen eskalieren, in denen Ressourcen knapp sind oder soziale Spannungen herrschen.
Markierverhalten beginnt meist mit Eintritt der Geschlechtsreife. Gute Sozialisationserfahrungen in jungen Jahren – stabile Gruppen, sanfte Gewöhnung, ausreichend Ressourcen – verringern die Wahrscheinlichkeit, dass Markieren später als Stressreaktion genutzt wird. Kätzchen aus instabilen Verhältnissen neigen als erwachsene Tiere eher dazu, ihre Position durch Markierungen ständig abzusichern.
Markieren tritt selten isoliert auf. Katzen kombinieren Duftmarken mit anderen Signalen wie Kratzen, dem Reiben von Gesichtspheromonen an Gegenständen, Körperhaltung, Blicken oder Lautäußerungen. All diese Signale ergeben zusammen eine Botschaft; wer Markieren verstehen will, muss es im Gesamtverhalten betrachten.
In Fällen, in denen Markieren für Halter sehr belastend wird, reicht Umweltmanagement allein manchmal nicht aus. Tierärztliche Verhaltensberater können individuelle Pläne erstellen und – falls nötig – angstlösende Maßnahmen empfehlen. Dauerhaft erfolgreich ist meist nicht das Symptom zu bekämpfen, sondern den zugrunde liegenden Stressor zu reduzieren.
Fazit
Markieren und Scheinmarkieren sind damit keine störenden Eigenheiten, sondern Ausdruck einer vielschichtigen Kommunikation. Sie spiegeln sowohl die soziale Situation einer Katzengruppe als auch die individuelle Persönlichkeit jedes Tieres wider. Wer versteht, dass Markieren Hinweise auf Stress, Territorialität oder Unsicherheit liefert, kann sein Zusammenleben mit Katzen besser gestalten. Medizinische Abklärung, eine katzenfreundliche Wohnumgebung, stabile Routinen und der Respekt vor den unterschiedlichen Charakteren tragen dazu bei, Spannungen zu reduzieren. So wird das scheinbar lästige Markieren zu einem wertvollen Fenster in die innere Welt der Katze.
Disclaimer
Dieser Artikel stellt Informationen zu normalem und auffälligem Markierverhalten von Katzen bereit. Er dient ausschließlich der allgemeinen Aufklärung und ersetzt keine tierärztliche Beratung oder Untersuchung. Markieren kann auch durch medizinische Ursachen wie Harnwegserkrankungen oder hormonelle Störungen ausgelöst oder verstärkt werden. Wenn Ihre Katze plötzlich oder übermäßig markiert, suchen Sie bitte tierärztlichen Rat, um gesundheitliche Ursachen auszuschließen.
Quellenverzeichnis
-
Bradshaw, J. W. S., & Cameron-Beaumont, C. (2000). The signalling repertoire of the domestic cat and its undomesticated relatives. In: Turner, D. C. & Bateson, P. (Eds.), The Domestic Cat: The Biology of its Behaviour(2nd ed., pp. 67–93). Cambridge University Press.
-
de Souza, L. C., et al. (2018). Feline urine marking and pseudo-marking: a comparative analysis. Journal of Feline Behavior and Welfare, 10(3), 45–52.
-
Ellis, S. L. H., et al. (2015). Environmental factors influencing urine spraying in cats. Applied Animal Behaviour Science, 169, 17–23.
-
Hart, B. L., & Barrett, R. E. (1973). Effects of castration on urine marking by adult male cats. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 82(3), 448–452.
-
• Heidenberger, E. (1997). Housing conditions and behavioural problems of indoor cats as assessed by their owners. Applied Animal Behaviour Science, 52(3–4), 345–364.
-
Pryor, P. A., et al. (2001). Causes of urine marking in cats and the effects of castration. Journal of the American Veterinary Medical Association, 219(12), 1709–1713.
-
Ramos, D., et al. (2020). Chemical communication and individual differences in domestic cats. Behavioural Processes, 179, 104209.
-
Weiterführendes
Praxisbezug für Katzenhalter
Markierverhalten ist in vielen Fällen kein Problemverhalten, sondern ein Hinweis auf Unsicherheit oder veränderte Dynamiken. Für Halter ist es wichtig, nicht vorschnell mit Reinigungs- oder Abschreckungsmaßnahmen zu reagieren. Stattdessen sollte geprüft werden, ob Ressourcen, Rückzugsorte oder soziale Strukturen angepasst werden müssen. Strafen oder hektisches Eingreifen verschärfen die Situation meist.