Wenn jeder Atemzug schwerfällt: Asthma bei Katzen im Fokus der Forschung
Asthma ist bei Katzen eine ernstzunehmende, chronische Erkrankung der Atemwege, die – unbehandelt – die Lebensqualität erheblich einschränken kann. Gleichzeitig zeigen aktuelle tiermedizinische Studien, dass mit gezielter Therapie und individueller Anpassung betroffene Tiere heute ein weitgehend beschwerdefreies Leben führen können. Doch wie entsteht felines Asthma überhaupt? Welche Therapien stehen zur Verfügung, und wie sicher ist die Prognose? Ein wissenschaftlicher Blick auf eine Erkrankung, die oft unterschätzt wird – bis zum ersten Anfall.
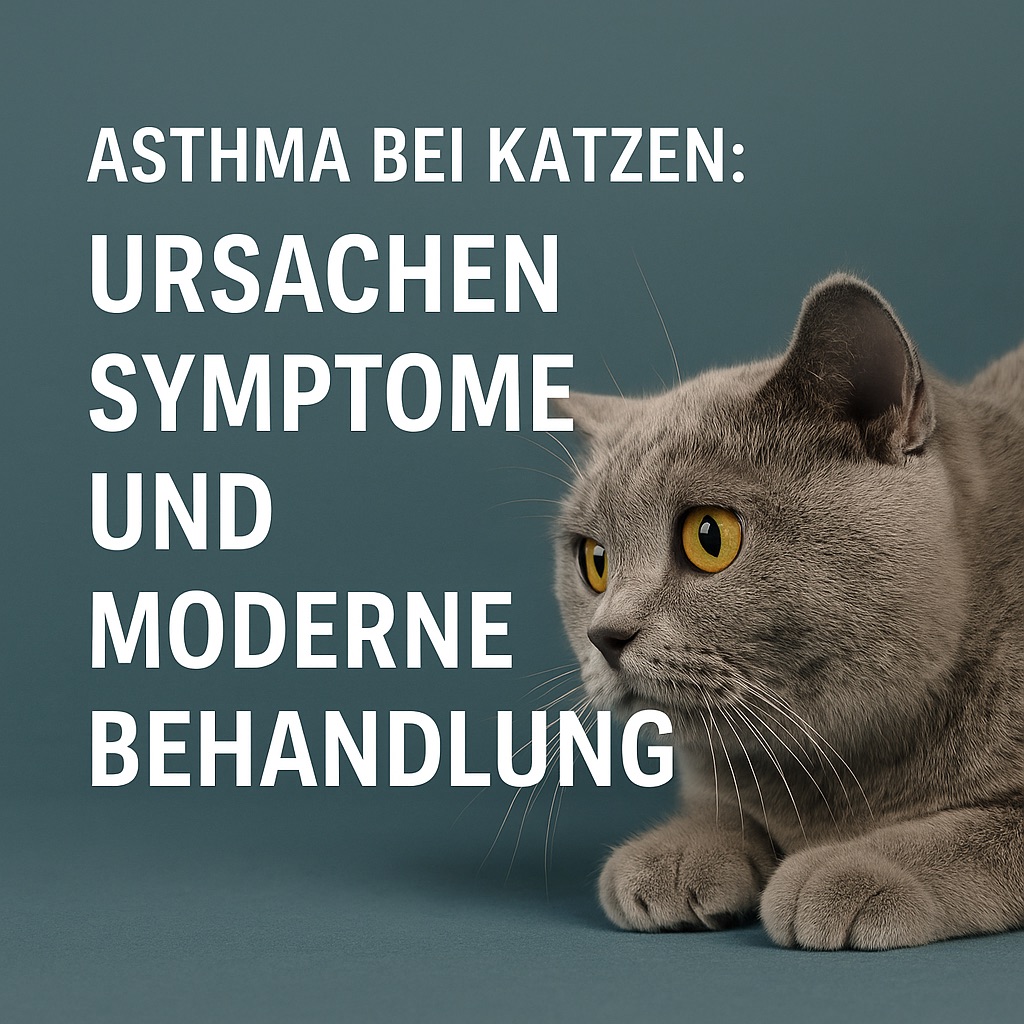
„Ein Husten ist kein Haarballen. Asthma bei Katzen wird oft übersehen – dabei zählt jede früh erkannte Atemnot.“ Katzengesellschaft.com
Was ist felines Asthma?
Asthma bei Katzen, auch als felines Asthma bronchiale bezeichnet, gehört zu den chronisch entzündlichen Atemwegserkrankungen und betrifft primär die Bronchien – also die unteren Atemwege. Die Pathophysiologie gleicht in vielerlei Hinsicht dem allergisch bedingten Asthma des Menschen. Eine übermäßige Reaktion des Immunsystems führt zu einer Entzündung der Bronchialschleimhaut. Diese reagiert mit einer verstärkten Schleimproduktion, Schwellung und krampfartiger Verengung der Bronchien. Besonders auffällig ist dabei, dass die Atemnot in der Regel beim Ausatmenauftritt, was die Erkrankung von vielen anderen Lungenerkrankungen unterscheidet.
Im klinischen Verlauf entwickeln viele Katzen typische Symptome wie anfallsartigen Husten, keuchende oder pfeifende Atmung, erhöhte Atemfrequenz oder sogar Maulatmung – letztere gilt als akuter Notfall. Nicht selten kommt es dabei zu einer Verwechslung mit dem „Würgen“ von Haarballen, was eine zeitgerechte Diagnose verzögert. Gerade zu Beginn zeigt sich Asthma oft unspezifisch und schleichend – ein Risiko, das eine systematische Beobachtung der Tiere im Alltag unerlässlich macht.
Ursachen und Risikofaktoren: Eine komplexe Reaktionskette
Der genaue Auslöser von Katzenasthma ist nach wie vor Gegenstand intensiver Forschung. Die Mehrheit der Fälle scheint jedoch eine allergische Komponente zu beinhalten. Hierbei reagieren die Immunzellen – insbesondere eosinophile Granulozyten – überempfindlich auf bestimmte Reize in der Atemluft. Dazu zählen Umweltallergene wie Hausstaubmilben, Pollen, Schimmelsporen oder Rauchpartikel. Neuere Studien, etwa von Reinero et al. (2021), zeigen, dass auch flüchtige organische Verbindungen (VOCs), wie sie in Reinigungsmitteln, Lufterfrischern oder parfümierter Streu enthalten sind, eine wichtige Rolle spielen können.
Besonders bemerkenswert ist, dass urban lebende Katzen laut aktuellen epidemiologischen Erhebungen (Smith et al., 2020) häufiger an Asthma erkranken als ihre ländlichen Artgenossen. Die erhöhte Feinstaubbelastung in Innenräumen – etwa durch Heizungsluft, Zigarettenrauch oder Kochdämpfe – scheint hier ein zusätzlicher Risikofaktor zu sein.
Ein weiterer Forschungsschwerpunkt liegt auf genetischen Prädispositionen. Während bislang keine eindeutige Rassedisposition nachgewiesen werden konnte, legen Beobachtungen nahe, dass orientalische Rassen wie Siamkatzen tendenziell häufiger betroffen sind. Das könnte mit einem veränderten Immunprofil oder einer besonderen Anfälligkeit des respiratorischen Epithels zusammenhängen, ist jedoch noch nicht abschließend geklärt.
Diagnose: Detektivarbeit zwischen Bildgebung und Labor
Die Diagnose von felinem Asthma erfolgt selten über einen einzelnen Test. Vielmehr handelt es sich um ein Zusammenspiel aus Anamnese, klinischer Beobachtung, bildgebenden Verfahren und Ausschlussdiagnostik. Besonders hilfreich ist eine Röntgenaufnahme des Thorax, auf der sich bei Asthma häufig eine sogenannte „donut pattern“-Struktur erkennen lässt – ein Hinweis auf verdickte Bronchialwände.
Ein Goldstandard in der Diagnostik ist die bronchoalveoläre Lavage (BAL), bei der mittels Spülung der unteren Atemwege zelluläres Material gewonnen wird. Bei asthmatischen Katzen zeigt sich dabei typischerweise eine eosinophile Entzündungsreaktion. Ergänzt wird die Diagnostik durch Blutuntersuchungen, parasitologische Kotanalysen (zum Ausschluss von Lungenwürmern) sowie in manchen Fällen durch eine CT-Untersuchung.
Wichtig ist der differenzialdiagnostische Ausschluss anderer Lungenerkrankungen wie chronischer Bronchitis, Lungenfibrose, Herzinsuffizienz oder Neoplasien, da sich die Symptome häufig überschneiden.
Therapie: Von Tablette bis Inhalator – individuell abgestimmt
Katzenasthma ist bislang nicht heilbar, aber sehr gut therapierbar. Zentrales Ziel ist es, die chronische Entzündung unter Kontrolle zu bringen und akute Anfälle zu vermeiden. Eine dauerhafte medikamentöse Behandlung ist dabei meist unumgänglich.
Das Rückgrat der Therapie bilden Kortikosteroide, welche die Entzündung nachhaltig hemmen. Häufig zum Einsatz kommt Prednisolon – entweder in Tablettenform oder als Inhalationslösung. Inhalative Kortikoide wie Fluticason (z. B. über das AeroKat®-System) ermöglichen eine lokale Wirkung bei gleichzeitig deutlich reduzierter systemischer Belastung. Die Akzeptanz der Inhalationstherapie hat sich laut klinischen Studien in den letzten Jahren deutlich verbessert – insbesondere bei Katzen, die frühzeitig und behutsam daran gewöhnt werden (Gunn-Moore, 2018).
Ergänzt wird die Therapie bei Bedarf durch Bronchodilatatoren wie Salbutamol, die im Akutfall die Atemwege erweitern. Auch diese können über das Inhalationssystem verabreicht werden.
Zunehmend rückt die Umgebungsoptimierung in den Fokus: Staubfreie Einstreu, rauchfreie Umgebung, Verzicht auf stark parfümierte Haushaltsprodukte und gute Luftzirkulation sind zentrale Elemente der nicht-medikamentösen Behandlung.
Prognose und Lebensqualität: Was Katzen brauchen, um gut zu leben
Die gute Nachricht: Die Prognose für Katzen mit Asthma ist heute in den meisten Fällen günstig – vorausgesetzt, die Erkrankung wird erkannt und konsequent behandelt. Viele Tiere führen bei stabiler Medikation ein nahezu normales Leben. Die Lebensqualität hängt dabei maßgeblich von der Compliance der Halter, dem frühzeitigen Erkennen von Verschlechterungen und der regelmäßigen tierärztlichen Kontrolle ab.
Unbehandelt kann Asthma jedoch zu schwerwiegenden Komplikationen führen – etwa zu dauerhaften Lungenschäden oder einem Status asthmaticus, einem lebensbedrohlichen, langanhaltenden Anfall mit massiver Atemnot. Deshalb gilt: Jede chronische Atemwegssymptomatik sollte tierärztlich abgeklärt und nicht bagatellisiert werden.
Ausblick: Was die Forschung verspricht
Aktuelle Studien befassen sich mit zielgerichteten Immunmodulatoren (z. B. monoklonalen Antikörpern), wie sie in der Humanmedizin längst Einzug in die Asthmatherapie gehalten haben. Auch die Rolle des Mikrobioms und seine Wechselwirkung mit dem Immunsystem wird zunehmend erforscht. Erste Ansätze deuten darauf hin, dass eine gesunde Darmflora das Entzündungsgeschehen in der Lunge mit beeinflussen könnte – ein spannendes Feld für zukünftige Therapiestrategien.
Quellen
-
Reinero, C.R. (2021). Feline lower airway disease. Journal of Feline Medicine and Surgery, 23(4), 313–327.
-
Smith, H. et al. (2020). Urban environment and feline asthma: Correlation of air quality and clinical incidence. Vet Respir Dis, 12(1), 45–52.
-
Gunn-Moore, D. (2018). Inhaled therapy for feline lower airway disease. Companion Animal, 23(7), 372–376.
-
Trzil, J.E. (2014). Diagnostic and therapeutic update on feline asthma. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 44(1), 117–133.
Disclaimer
Dieser Artikel basiert auf veterinärmedizinischer Fachliteratur und aktuellen wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Er dient der allgemeinen Information und ersetzt keinesfalls eine tierärztliche Untersuchung oder individuelle Therapieempfehlung. Wenn Ihre Katze Atemnot, Husten oder andere Symptome zeigt, wenden Sie sich bitte umgehend an eine Tierärztin oder einen Tierarzt.